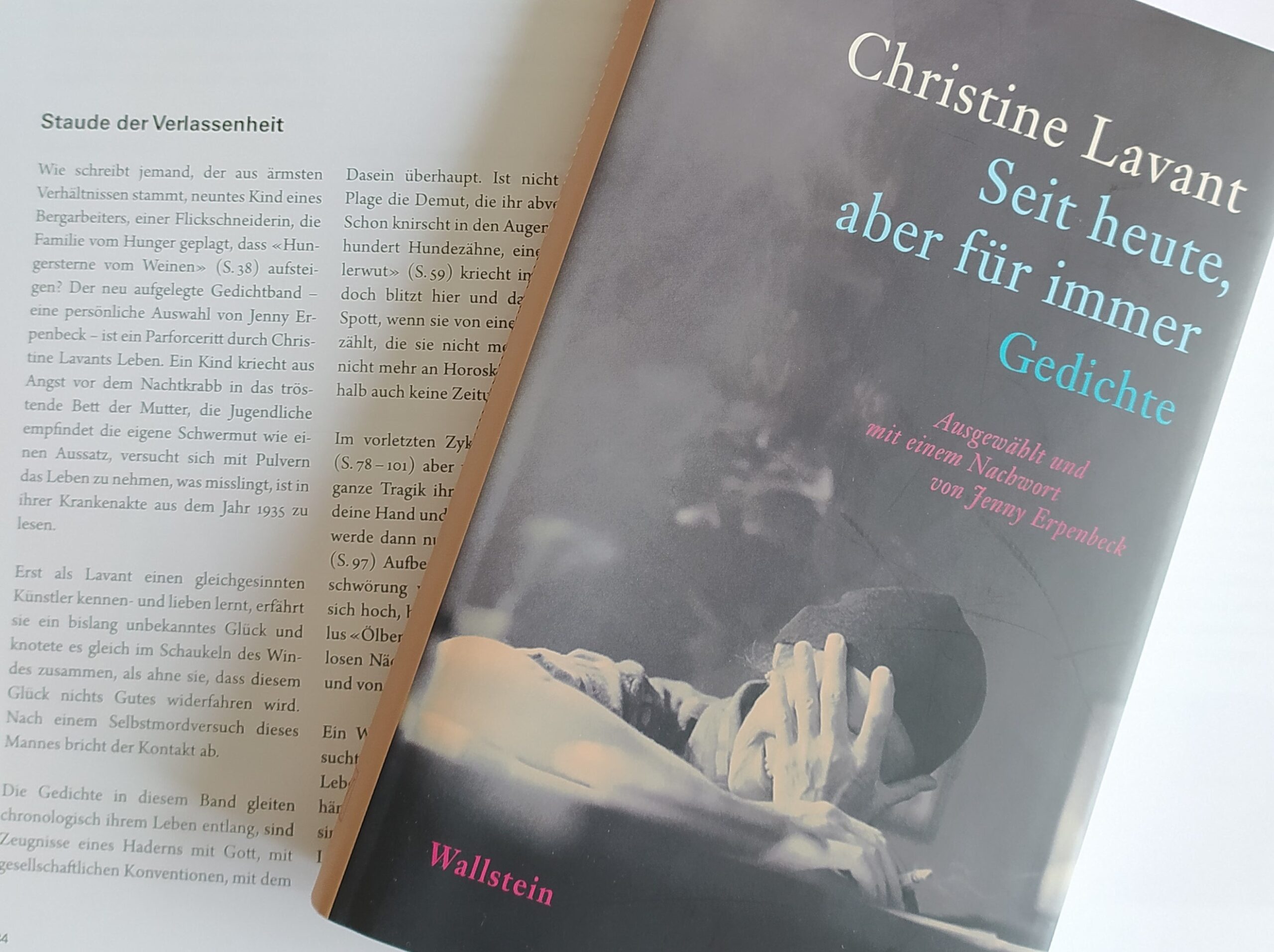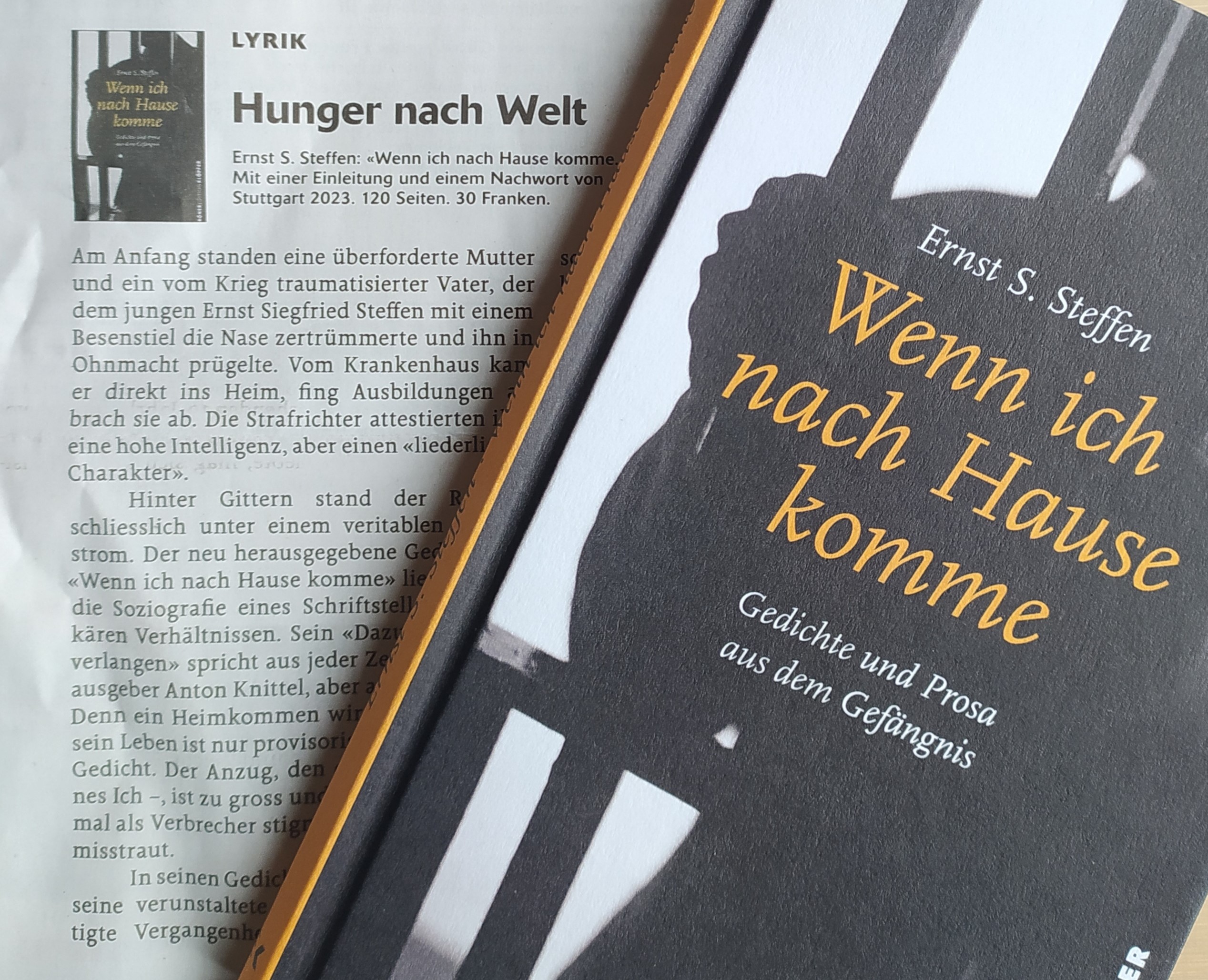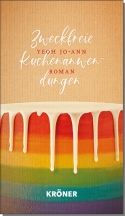Gibt es im deutschsprachigen Raum einen Roman über die Gezi-Proteste in Istanbul, einen, der so hineinkriecht in die gesellschaftlichen Verästelungen der Nach-Gezi-Zeit? Wer, wenn nicht die Türkisch-Übersetzerin Sabine Adatepe könnte darüber so anschaulich schreiben? Zwar war sie nicht selbst dabei, gab aber eine Gezi-Anthologie heraus. Wie es nun zum Roman Lichtblau #Mavi kam, erzählt sie in diesem Interview.
Wie hast Du Deine Figuren gefunden, die unterschiedlicher nicht sein könnten? Da ist zum Beispiel Marie, die sich vor dem Nachtmahr fürchtet, die an Mollträumen leidet, von denen sie sich aber nicht unterkriegen lassen will angesichts der Katastrophen auf diesem Planeten. Oder Lea, eine junge Studentin, die sich zunächst einfach nur treiben lässt und Straßenpoesie sammelt („Das Glück ist ein Streichholz, solange es eben brennt.“) und sich immer weiter, immer tiefer auf die Protestbewegung einlässt. Und die Dritte, Imke, eine lebensfremde, vom Leben verstörte Seniorin, der das Leben abhanden gekommen ist, weil sie sich immer davor fürchtet, etwas zu versäumen, was sie ihr ganzes Leben lang versäumt hat; die wegen ihrer Kinder den Beruf und damit auch gleich das eigene Leben an den Nagel gehängt hat. Wie nur bist Du auf ihre Geschichten gekommen?
Mich trieben schon länger einige Themen um: Stadtkultur und -entwicklung, Gentrifizierung und StreetArt, Tourismus-Kritik, bikulturelle Beziehungen, Kriegskinder und transgenerationale Weitergabe von Traumata, Kontaktabbruch in Familien, dazu kamen 2013 die Gezi-Proteste und mit ihnen das Phänomen Straßenpoesie. Bei einem Gang durch die Hamburger Hafencity im Herbst 2013 blitzte die Idee auf, diese Themen anhand von drei Frauen aus drei Generationen zwischen Hamburg und Istanbul zu erzählen. Die drei Protagonistinnen waren sofort da, übernahmen ihre jeweiligen Themen und brachten quasi ihre Geschichten mit. Einige Fragmente davon sind lebenden Vorbildern entlehnt, natürlich habe ich auch manch eigene Erfahrungen verarbeitet, sodass ich in allen Dreien ein wenig drinstecke, ohne die eine oder andere explizit zu „sein“.
Dein Roman schlägt ein hohes Tempo an, die Geschichte drängt, als müsse sie raus, so dicht geschrieben, so scharf geschnitten, als wärst Du bei den Protesten mit dabei gewesen, er ist so voller Details, dass man meinen könnte, Du hättest mitgemacht.
Ich war nicht selbst im Park dabei, habe die Proteste aber atemlos aus der Ferne verfolgt und unterstützt, mit Posts und Übersetzungen, dann mit der Herausgabe des Bandes Gezi: Eine literarische Anthologie, zu dem neunzehn Autor:innen, die alle unmittelbar involviert waren, beigetragen haben. Besonders wichtig für die möglichst authentische Rekonstruktion des Geschehens im Park und die Atmosphäre ringsum waren für mich zum einen Fotos der Fotografin Selen Özer-Günday, die sie uns für die Anthologie zur Verfügung gestellt hatte, und zum anderen der Dokumentarfilm „Gözdağı“ (Die Blendung, 2014, von Can Dündar), für den ich die deutschen Untertitel erstellt hatte. Mit dem Schreiben konnte ich auch mein Bedauern darüber kompensieren, nicht unmittelbar dabei gewesen zu sein.
Wie bist Du beim Schreiben vorgegangen? Hast Du zuerst die eine Figur geschrieben, dann die zweite, dann zusammengeschnitten?
Nein, die drei Figuren liefen parallel zueinander, ihre Kapitel im jeweiligen Wechsel entstanden fast genau in der Reihenfolge, wie sie im Roman stehen. Fast, sage ich, denn auf Anregung des Verlags teilte ich zugunsten von Spannungsbögen und Cliffhangern am Ende doch noch das ein oder andere Kapitel und stellte ein wenig um.
Du schreibst und übersetzt ja auch selber, auf S. 209 habe ich sogar eine Anspielung auf den populären jungen wilden Autor Hakan Günday gefunden, einen Autor, dessen Werke Du übersetzt hast. Kannst Du etwas zu diesen beiden „Schreibvorgängen“ sagen, welche Unterschiede gibt es, Gemeinsamkeiten, Inspirationen?

© M.K.Adatepe
Beim Schreiben empfinde ich Selbstwirksamkeit viel eher als beim Übersetzen. Den Schreibprozess erlebe ich als weit kreativer und freier, als inspirierender, tiefgehender, ja, befriedigender. Übersetzen ist ein wenig wie Puzzeln, was ich als Kind sehr geliebt habe. Das richtige Teil für die richtige Stelle finden oder eben das richtige Wort in meiner Sprache für den bereits vorhandenen Text, also für die Gedanken einer oder eines anderen. Das macht mir auch heute noch Spaß, zudem baue ich gern kulturelle Brücken. Aber wenn ich Texte übersetze, hinter denen ich nicht wirklich stehen kann, ob inhaltlich oder sprachlich, was nicht eben selten vorkommt, überfällt mich mitunter ein Gefühl von Ennui, wie es vielleicht in jedem Brotberuf der Fall ist.
Da ich mich emotional und mental stark auf meine jeweilige Aufgabe einlasse, sozusagen im Text lebe, ob beim Übersetzen oder beim Schreiben, gelingt es mir nicht, beides parallel zu betreiben. Ich brauche Abstand vom Übersetzen, um schreiben zu können. Eigentlich hatte ich das Übersetzen immer als Station auf dem Weg zum Schreiben gedacht. Es hindert mich aber eher am Schreiben als mich dorthin zu führen. Dennoch würde ich das literarische Übersetzen aus dem Türkischen als Traumberuf für mich bezeichnen – solange ich vom Schreiben nicht leben kann.
Woher kam die Idee zu den hashtag-Untertiteln der Kapitel, die Du immer sehr gut getroffen hast?
Die hashtag-Untertitel sind eine Reminiszenz an #şiirsokakta, Poesie auf der Straße. Unter diesem Hashtag wurden während und nach den Gezi-Protesten zahllose Gedichtzeilen und Sinnsprüche auf Mauern gesprayt und im Internet geteilt, wie es im Roman ja auch beschrieben wird. Heute sind Hashtags ein alter Hut, aber 2013, als ich zu schreiben anfing, wurden sie vor allem auf Twitter gerade erst populär. Darüber hinaus sind die Hashtag-Titel ein Augenzwinkern hin zu Marie, der mittleren der drei Romanfiguren: Die sozialen Medien sind zu Beginn des Romans Neuland für sie, mit dem praktischen Hashtag zur Schlagwortsuche aber freundet sie sich rasch an.
Am Ende führst Du die Splitter oder Lebensscherben der Protagonistinnen und der Bewegung zusammen in der japanischen Kunst des Kintsugi, in der man etwas so repariert, dass die Spuren zu sehen sind – ein grandioser Schachzug.
Im Roman bleibt die Studentin Lea nach der Niederschlagung der Gezi-Proteste etwas planlos in Istanbul, macht sich auf die Suche nach ihrem Vater und lebt – Achtung Spoiler :) -, als sie ihn findet, eine Zeitlang bei ihm im kurdischen Diyarbakır. Dort lernt sie eine ältere Silberschmiedin kennen, die Lea später, als sie nicht über den erneuten Kontaktabbruch des Vaters hinwegkommt, unvermutet auffängt. Auf ihren Spuren will Lea dann selbst in Richtung Silber- oder Goldschmiedekunst gehen. Doch auf dem Weg dorthin stieß ich in einem Berliner Teegeschäft zufällig – falls es Zufälle überhaupt gibt – auf wunderschöne Schalen mit goldenen Adern, die ich für Verzierungen hielt. Das sei Kintsugi, erklärte mir die Verkäuferin, eine japanische Reparaturkunst. Ich recherchierte und erfuhr, dass Kintsugi als Goldverbindung einen Makel nicht kaschiert, sondern hervorhebt und veredelt. Da war sofort klar: Kintsugi ist das einzig Richtige für Lea mit ihrem gebrochenen Herzen. Und sie ist ja nicht die einzige im Roman, die einiges in ihrem Leben zu „kitten“ hat. Es ist nicht meine Art, etwas zu übertünchen oder zu kaschieren, also sollten auch meine Figuren ihre „Bruchstellen“ annehmen und als Bereicherung verstehen. Dafür ist Kintsugi geradezu ideal.
Sabine Adatepe: Lichtblau #mavi, Frankfurt am Main: Größenwahn Verlag 2022, 272 Seiten
Mehr über türkische Kultur und Literatur lässt sich auf meinen Blog nachlesen.