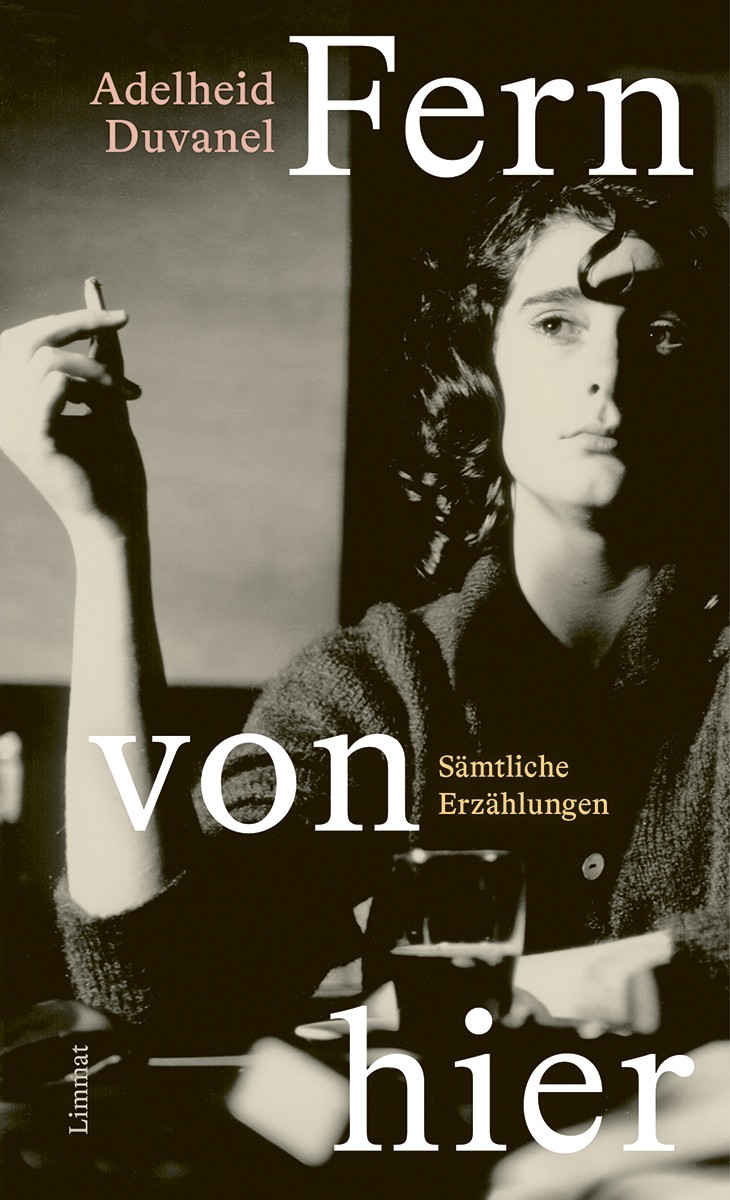Interview mit Stefanie Jacobs über den Roman Bestiarium von K-Ming Chang
Eine Familiengeschichte über drei Frauengenerationen hinweg ist dieser Debütroman der US-taiwanischen Autorin K-Ming Chang: Es geht um Tigergeist und Tigerschwanz, viele Löcher, die offenen Fragen gleich gestopft werden müssen, vergrabenes Gold und verbuddelte Briefe. Ein wortwuchtiger Roman, dessen Lektüre mich – zugegeben – ratlos macht.
Stefanie, ist das Dein erster Roman, den Du aus dem US-asiatischen Kontext übersetzt? Und wie bist Du mit den taiwanischen Bezügen umgegangen, wie hast Du recherchiert?
Ja, es ist der erste Roman aus diesem Kontext, und deshalb habe ich auch mit meiner Zusage kurz gezögert – kann ich diesem Text gerecht werden? Ich hatte jedoch schnell den Eindruck, dass die taiwanischen Bezüge zwar wichtig sind, aber nicht den Kern des Romans ausmachen. Um erst mal eine Vorstellung von der Kultur zu bekommen, habe ich dann zum Beispiel den „Fettnäpfchenführer Taiwan“ gelesen, der zwar eigentlich für Touristen gedacht ist, mir aber trotzdem geholfen hat. Dazu natürlich im Netz recherchiert, die eine oder andere Doku auf YouTube gesehen, klar. Bei den konkreten Fragen hat mir dann meine liebe Kollegin Karin Betz weitergeholfen, mit der ich ein-, zweimal gezoomt habe.
Was hat es mit den Briefen der Großmutter auf sich, die sich auch typografisch stark abheben? Die Sätze sind unvollständig und haben große Löcher. Wollen Sie uns etwas über die facettenreiche Familiengeschichte erzählen oder wie sich Identitäten über Ozeane hinweg aus Fragmenten zusammensetzen? Das gilt ja auch für die Ama, die mittlere Frauenfigur: ihr Vater ist ein chinesischer Soldat, der in den 50er Jahren vom Festland auf die „Insel“ kam, wie Taiwan im Roman genannt wird; die Mutter ist eine Atayal, eine der 16 indigenen Volksgruppen Taiwans. Später zieht die Familie in die USA, dort werden weitere Identitätsstücke angesetzt … Es kommt zu spannungsreichen Begegnungen wiederum mit Chinesen aus der VR China. Da ist z.B. Ben, ein kräftig-kerniger Mädchencharakter aus der Autonomen Region Ningxia, mit der sich die Jüngste der Familie in eine heftige Liebesbeziehung verstrickt, oder der streitbare Nachbar aus Sichuan. Und zwischendrin immer wieder diese Briefe, viel Gewalt und ein Stück verworrene Familiengeschichte. Wie liest Du den Roman?

Eine wichtige Botschaft lautet aus meiner Sicht, dass man Dinge in sich trägt – Familiengeschichten, Herkunft, Traditionen –, gegen die man sich letzten Endes nicht wehren kann, mit denen man früher oder später konfrontiert wird und denen man sich deshalb bestenfalls ein Stück weit hingibt, statt sich dagegen zu wehren. Die Jüngste der Familie etwa muss ja doch feststellen, dass sie mit ihrer Mutter und Großmutter mehr gemein hat, als ihr lieb ist. Und in diesem Kontext ergeben für mich auch die Löcher einen Sinn: Sie spucken ihr, ob sie es will oder nicht, Briefe ihrer Großmutter aus, die tatsächlich zu Fragmenten ihrer Identität werden oder es längst sind. Das Lückenhafte dieser Briefe passt im Grunde genommen auch ganz gut, wenn man sich überlegt, dass das, was man über die eigenen Großeltern weiß oder in Erfahrung bringen könnte, zumeist eher fragmentarischen Charakter hat und vielerlei Deutungen zulässt. (Je nachdem, ob die Großeltern noch leben, wie alt sie sind und woran sie sich aus ihrem Leben noch erinnern.)
Auch die Gewalt, die im Roman an vielen Stellen präsent ist, gehört zu den Dingen, von denen sich die Tochter nicht so weit distanzieren kann, wie sie gern würde, tut sie ihrem Großvater doch später, ohne es zu wollen, selbst Gewalt an. Was mir das Buch gesagt hat: Eine Familie ist ein mit Erlebnissen und Geschichten dicht verwobenes Gebilde, aus dem sich niemand ohne Weiteres ganz befreien kann.
Welche Schwierigkeiten hattest Du beim Übersetzen dieses stellenweise kryptischen, dann aber wieder flippigen Textes?
Kryptisch trifft es gut. Nicht selten musste ich erst einmal überlegen, was überhaupt gemeint ist und worauf Bezug genommen wird. Wenn ich mich dann für eine Deutung entschieden hatte, galt es, dem deutschen Satz eine ähnliche klangliche und/oder rhythmische Qualität zu verleihen. Eine wichtige Frage beim literarischen Übersetzen lautet ja grundsätzlich: Warum hat die/der Autor:in genau diese Formulierung gewählt und keine andere? Bei Chang kam ich überdurchschnittlich oft zu dem Schluss, dass vor allem die, ich nenne es jetzt einmal „sensorische“ Qualität eines bestimmten Wortes ausschlaggebend war: Wie klingt es? (Fast schon: Wie schmeckt es? Wie fühlt es sich beim Aussprechen an?) Ist es eher ein helles oder ein dunkles Wort? Ist dieser Satz eher eine Maschinengewehrsalve oder ein flatternder Drachen im Wind?
Sprachlich ist dieser Text ja wirklich gewaltig, die Bilder sind einzigartig: „Die Zähne unserer Mutter waren vor lauter Lügen ganz brüchig“, „Weil er statt Hirnwindungen Schlangen im Schädel hat“, „Nur dass Ma ihr Leben nicht in Jahren, sondern in Sprachen zählt“, „Der Fisch schmeckte metallisch, es stecken zu viele Erinnerungen an das Meer in seinen Gräten“. So könnte ich weiter aufzählen und meinen Bleistiftrandnotizen entlangschreiben. Wie bist Du beim Übersetzen dieser Bilder vorgegangen?
Für mich lag der Schlüssel beim Übersetzen dieses Textes darin, mich nicht zu wehren, sondern mich ihm im Zweifelsfall einfach hinzugeben. Nicht immer bis zum Letzten durchdringen zu wollen, wie diese oder jene Szene zu deuten ist, sondern sie in ihrer ganzen Wucht in mich aufzunehmen, dort wirken zu lassen und dann wieder zu Papier zu bringen. Und so etwas macht mir persönlich durchaus Spaß: Selbst beim soundsovielten Überarbeitungsgang ploppen hier und da neue Assoziationen und Wortideen auf, und bei so einem Text darf man seinem Affen ja auch mal Zucker geben. Insofern: Bestiarium war in übersetzerischer Hinsicht sicherlich eine Nuss, aber wenn man Freude am Knacken hat, auch ein Schmankerl.
Worin liegt für Dich die Stärke dieses Romans?
In der noch ungezähmten Spielfreude und bewundernswerten Furchtlosigkeit der jungen Autorin. Vielleicht schießt sie manchmal übers Ziel hinaus, aber hey, Bestiarium wird nie langweilig oder vorhersehbar, sondern ist einfach erfrischend anders. Einige der eingestreuten Fabeln werden mich z.B. in ihrer prägnanten Bildhaftigkeit – das Krabbenmeer an Deck des Piratenschiffs! – noch lange begleiten, auch wenn ich nicht genau weiß, was sie mir letzten Endes sagen wollen (Ich bemerke gerade eine Parallele zu den Songtexten von Bob Dylan, die ja auch oft einprägsame und faszinierende Geschichten erzählen, in denen vieles offen bleibt.) Richtig stark finde ich auch die Liebesgeschichte. Dass es eine queere Liebesgeschichte ist, wird gar nicht groß thematisiert, und das ist auch nicht nötig, denn die Szenen zwischen der Jüngsten und ihrer Freundin Ben (eine der coolsten Figuren des Buchs!) wirken so glaubhaft, natürlich und unerschrocken, dass es einfach Spaß macht.
K-Ming Chang: Bestiarium. Aus dem Englischen von Stefanie Jacobs. Hanser Verlag, 2021.