Wien? Ohne Wien.
Wien? Welches Wien?
Wien? Verrutscht.
Wien? Ausgeblutet.
Wien? Eine Unwirklichkeit.
Wien? Zerschunden.
Wien? Leergeräumt. Ein Tosen oben, ein Dröhnen unten, dazwischen Stille. Scherbenwelt, Trümmerbruch, Geisterstadt. Alle Regeln aufgehoben, keine Stadt, keine Gesetze.
So oder so ähnlich beginnt Autolyse. Erzählungen vom Ende von Karin Peschka. Was auch immer geschehen war, es hatte viel Schaden angerichtet. Auch in der Wohnung einer Rentnerin, die trotz bester Vernetzung im Alter, trotz Smartphone und Internet nun eingesperrt auf ihren Tod wartet. Denn „draußen nach wie vor Getöse, vom Himmel fallende Wut.“ Der Brand fegte durch Straßen, höhlte Häuser aus. Autos liegen quer übereinander, die Alarmanlangen verstummten erst nach ein paar Tagen, die Warnblinkanlagen erlöschten irgendwann. Zwischen Brüchen und Rissen flackert das Straßenlicht.
Was ist passiert?, will eine andere wissen, steigt aus dem Auto, und plötzlich bewegt sich der Boden, ein Ruck, sie stürzt. „Darüber ein gelblicher Himmel mit blauroten Lücken.“ Ein Kapitän fährt auf dem Fluss hinein in die Stadt, in ein Dunkel – wo einst optische Verschmutzung den Himmel hell erleuchtete, flockt nun der Nebel, das Ufer ist wenig mehr als eine Skizze. Ein anderer hat vier Finger verloren, weil ein Fassadenteil direkt auf seine Hand fiel, glatter Schnitt. „Trümmerte es, polterte und hallte nach. War wieder still. So ging es die ganze Zeit.“
Katastrophenvorsorge versagt angesichts dieses überwältigenden Etwas, das keine der Figuren in Worte zu fassen vermag. Ein Mäandern um die konkrete Benennung, und jeder nennt es anders. Zumal man damit beschäftigt ist herauszufinden, wie man mit (dem) Nichts überlebt. Und die irrlichterne Hoffnung, dass es nur ein schlechter Traum sei, dass schon bald Flugblätter abgeworfen werden würden, die einem sagen, wohin, mit Überlebenspaketen an kleinen Fallschirmen.
Die anderen? Menschen schon auch, aber selten, sie irren herum, eine aussterbende Spezies. Aus dem Rauch der Stadt ertönt fernes Hundegebell. Tiere erobern sich die Stadt zurück, hausen in Ruinen wie in anderen Katastrophengebieten, nachzulesen auch in Adolf Muschgs neuem Roman Heimkehr nach Fukushima. Dort sind es Wildschweine, die sich in einem Haus niedergelassen haben und es gegen die Rückkehrer verteidigen.
Die Tierwelt ist bei Karin Peschka nicht nur Begleiterscheinung, sondern Kommentar zu menschlichem Versagen. Einer stellt um des Überlebens willen Fallen auf, dreht einem Vogel rasch den Hals um, bevor das Geschrei den Aufenthaltsort verrät. Anderswo sind die Aquarien in einer Tierhandlung zerbrochen, die Tiere verenden in den Scherben, Reptilien sind geflohen.
In der längeren Erzählung „Ich“ wühlt sich jemand durch die Stadtlandschaft, zuerst auf der Suche nach Medikamenten gegen eine Autoimmunerkrankung, später nach Möglichkeiten der titelgebenden Autolyse, „denn wenn es niemanden mehr gibt, der dich begraben kann, musst du dich selbst darum kümmern.“ Zuvor aber die Krankheit besiegen, ein Geflecht aus Gängen durchwuchert den Körper, krampfige Schmerzen, eine Faust im Oberbauch, damals gab es noch Hausärzte und Spritzen, doch es wurde trotzdem alles schlimmer, dann aber Rettung, und die Krankheit ebbte ab. Jetzt aber war ohnehin alles gleichgültig, das Überleben ungewiss, ein Experiment vielleicht nur diese Katastrophe.

© Taha Alkadhi
Karin Peschka verweist mich in eine Düsternis, die zu durchringen reizvoll ist, weil sie sprachlich virtuos glitzert. Das erste Mal ist mir die Autorin mit zwei Texten in der Anthologie „Die Sachensucherin“ aufgefallen. Dort war es ein Traktorfahrer, in dessen Dreck eine Motorradfahrerin ausrutscht. Ein kurzer, harter Aufprall – die Sätze knallen beim Lesen im Ohr. Und Tiere bilden eine seltsame Kulisse, als seien sie das Fragezeichen zum Text. In „Am Morgen, am Pier“ entblösst sich gleichsam die Stadt, denn ein nackter Mann liegt da und fordert Aufmerksamkeit ein. Später dann freute ich mich, dass „Wiener Kindl“ – der dritte Teil von Autolyse Wien -, 2017 mit dem Publikumspreis des Ingeborg-Bachmannpreises ausgezeichnet wurde. Ein Kind überlebt in den Ruinen Wiens, vergessen, verlassen von seiner Familie, aufgenommen in ein Rudel Hunde – kein Text, der einem breiten Publikumsgeschmack entspricht, möchte man meinen, deshalb freut mich der Preis umso mehr, denn er unterschätzt nicht mehr länger das Publikum, von dem so viele Verlage behaupten, sie wüssten, wie es ticke.
„Ich habe in meinen Texten den Hang zum Dunklen, mich interessieren Grenzerfahrungen“, sagt Karin Peschka in einem Interview. Das ist aber nicht alles, warum nur habe ich beim Lesen das Gefühl, die Autorin will dem Dunkel etwas Licht abringen?
Wien? Ausgelöscht. Das einzige Licht von einem fernen Vollmond.
Karin Peschka: Autolyse Wien. Erzählungen vom Ende. Otto Müller Verlag, 2017
 Als ich in Korfu den Namen Iason Depountis erwähne, der hier geboren wurde, ernte ich selbst in der Lesegesellschaft einen überraschten Blick. Schließlich findet die Bibliothekarin die Titel im Computer. Und während sie die Bücher zusammensucht, lasse ich meinen Blick über den Boden und die Regale schweifen, in denen vor lauter Wurmstichigkeit die Buchrücken abfallen, sich die Gänge der Würmer auf den Buchblöcken abzeichnen, inbesondere die Autoren unter M wie Machiavelli sind davon betroffen.
Als ich in Korfu den Namen Iason Depountis erwähne, der hier geboren wurde, ernte ich selbst in der Lesegesellschaft einen überraschten Blick. Schließlich findet die Bibliothekarin die Titel im Computer. Und während sie die Bücher zusammensucht, lasse ich meinen Blick über den Boden und die Regale schweifen, in denen vor lauter Wurmstichigkeit die Buchrücken abfallen, sich die Gänge der Würmer auf den Buchblöcken abzeichnen, inbesondere die Autoren unter M wie Machiavelli sind davon betroffen.
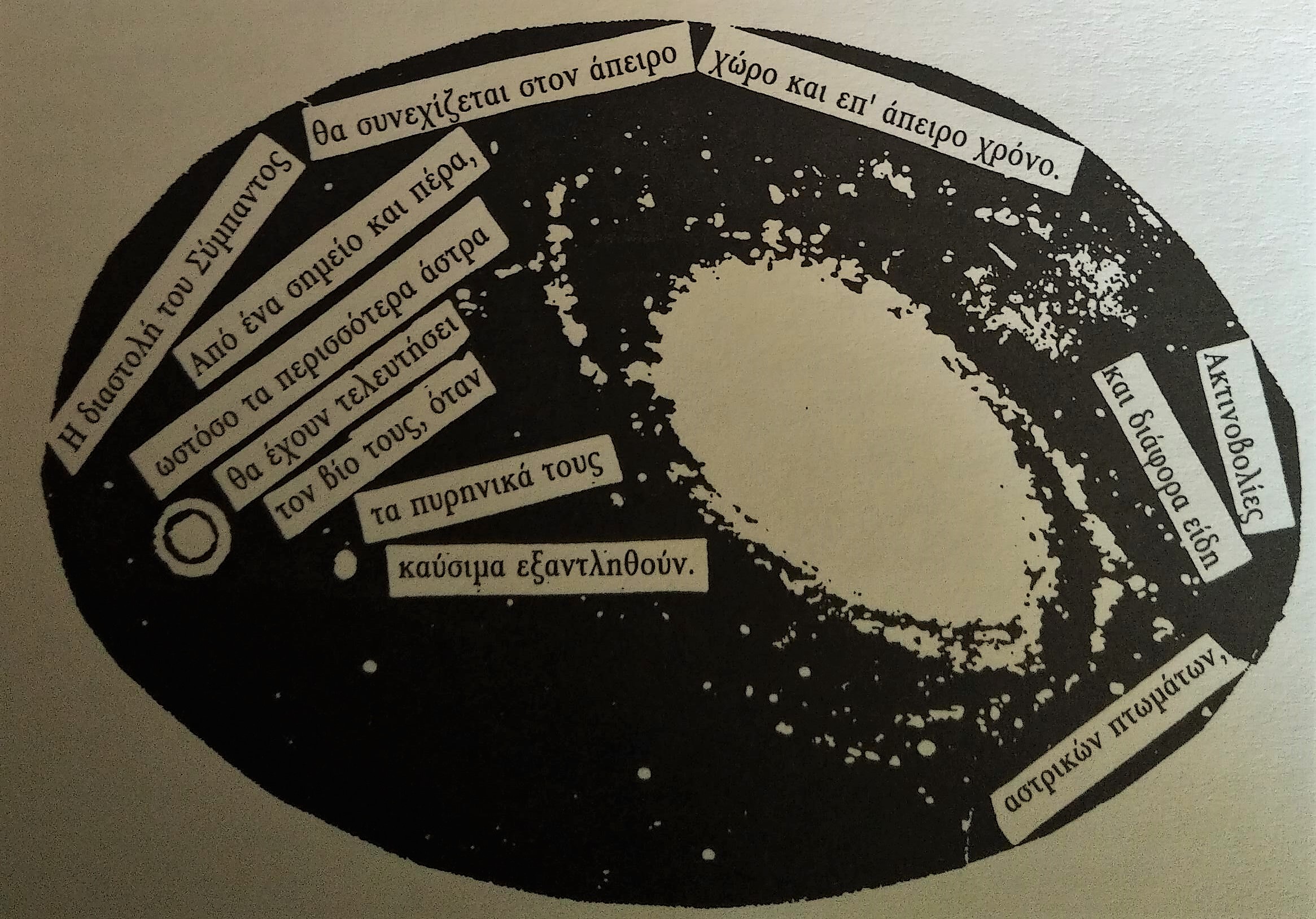
 Zum Schwäbischen Literaturpreis hat es nicht gereicht, aufgenommen wurde meine Ezählung „Kieselstein“ dafür in die Anthologie „Schönheit“. Peter Fassl schreibt in seinem Vorwort dazu: „Was soll eine fünfzigjährige Frau machen, die von ihrem beruflich erfolgreichen Mann für eine jüngere Partnerin verlassen wird? Fitness, Meditation, gesunde Ernährung, Schönheitkorrekturen – aber Zeichen der Trauer und Entttäuschung bleiben.“
Zum Schwäbischen Literaturpreis hat es nicht gereicht, aufgenommen wurde meine Ezählung „Kieselstein“ dafür in die Anthologie „Schönheit“. Peter Fassl schreibt in seinem Vorwort dazu: „Was soll eine fünfzigjährige Frau machen, die von ihrem beruflich erfolgreichen Mann für eine jüngere Partnerin verlassen wird? Fitness, Meditation, gesunde Ernährung, Schönheitkorrekturen – aber Zeichen der Trauer und Entttäuschung bleiben.“

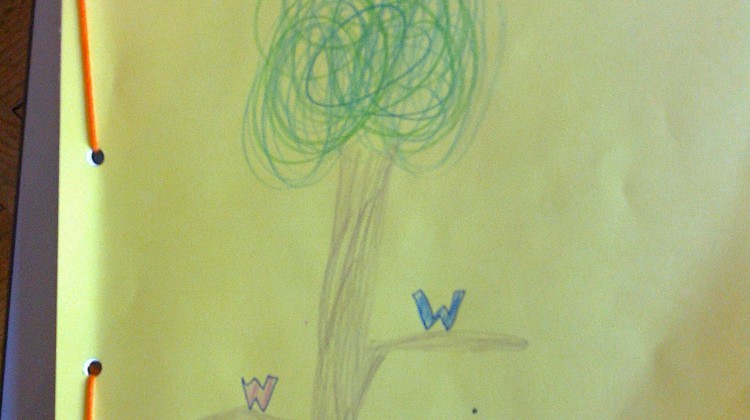
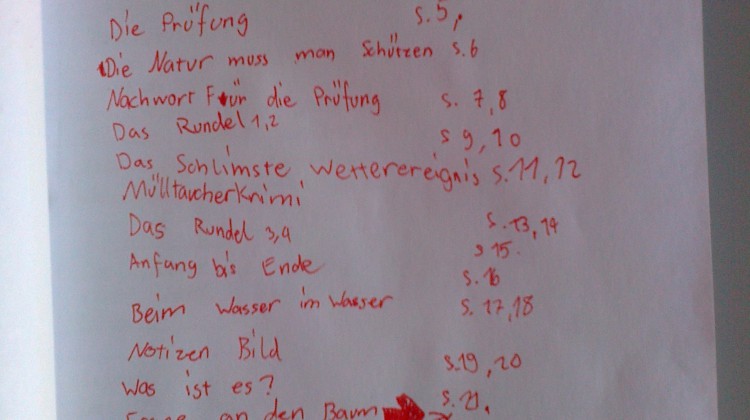



 Das finde ich das Allerschwierigste. In Alte Feinde habe ich einen Erzählstrang eingebaut, in dem ein Revolver im Mittelpunkt steht. Er wechselt in jedem Kapitel den Besitzer, die LeserInnen erleben unterschiedliche Seiten des Bürgerkriegs, ohne dass ich viel erklären muss. In anderen Büchern sind es die Figuren selbst, die auf einem bestimmten Fachgebiet tätig sind oder bestimmte Ansichten vertreten, die sie in Dialogen äußern. Auch die Menge an Informationen sind Geschmacksache. Manche LeserInnen interessieren sich eher für die Handlung, andere wiederum auch für die Hintergründe.
Das finde ich das Allerschwierigste. In Alte Feinde habe ich einen Erzählstrang eingebaut, in dem ein Revolver im Mittelpunkt steht. Er wechselt in jedem Kapitel den Besitzer, die LeserInnen erleben unterschiedliche Seiten des Bürgerkriegs, ohne dass ich viel erklären muss. In anderen Büchern sind es die Figuren selbst, die auf einem bestimmten Fachgebiet tätig sind oder bestimmte Ansichten vertreten, die sie in Dialogen äußern. Auch die Menge an Informationen sind Geschmacksache. Manche LeserInnen interessieren sich eher für die Handlung, andere wiederum auch für die Hintergründe.

 Warum ich schreibe, was mich umtreibt und wichtig ist – das haben Dana Grigorcea und Perikles Monioudis aus mir herausgekitzelt. Diese Fragen habe mich ganz schön in die Enge getrieben und dazu angeregt, mir über mein eigenes Schreiben einmal Gedanken zu machen.
Warum ich schreibe, was mich umtreibt und wichtig ist – das haben Dana Grigorcea und Perikles Monioudis aus mir herausgekitzelt. Diese Fragen habe mich ganz schön in die Enge getrieben und dazu angeregt, mir über mein eigenes Schreiben einmal Gedanken zu machen.