Damit habe ich nicht gerechnet, nicht mit braunem, aufgewühltem Hochwasser und Stromschnellen. Im Regen stellten wir die Zelte auf, schon am nächsten Tag sollte es losgehen. In der Nacht warf ich mir vor, noch nie überlegt zu haben, was in einem Notfall geregelt sein müsste, gleich anderntags wollte ich das nachholen, was im Falle des Falles zu tun wäre, und wälzte mich in dieser Nacht auf einer dünnen Matte, die Gelenke schmerzten, und nie mehr – das nahm ich mir fest vor – würde ich so wahnsinnig sein, eine solche Outdoor-Reise zu buchen.  Offensichtlich hatte ich nicht wirklich über die Einzelheiten nachgedacht: zehn Tage nur mit dem Notwendigsten auf einem mongolischen Fluss. Bei meinen Recherchen vorab im Internet fand ich den Strom, der gegen Norden Richtung Russland fließt, eher flach, als müsste man an manchen Stellen das Boot gar tragen oder ziehen, so wenig Wasser führte er mit sich. Dass der Fluss bei doppelt so hohem Wasserstand eine doppelt so starke Strömung hatte, lag nun klar auf der Hand; dass unsere Kleider allesamt nass werden würden, wenn wir bei einer Stromschnelle kenterten, fürchtete ich. An weitere mögliche Szenarien mochte ich gar nicht denken. Kein Vogel am niedrigen grauen Himmel, den ich nach Zeichen von Wetterverbesserung absuchte. Und auch keine Pferde, nach denen eine Nomadin Ausschau hielt. Seit Tagen schon war jede Spur von der kleinen Herde verschwunden, nun fürchtete sie, Wölfe würden sie attackieren. Am Abend war auch die Nomadin weg.
Offensichtlich hatte ich nicht wirklich über die Einzelheiten nachgedacht: zehn Tage nur mit dem Notwendigsten auf einem mongolischen Fluss. Bei meinen Recherchen vorab im Internet fand ich den Strom, der gegen Norden Richtung Russland fließt, eher flach, als müsste man an manchen Stellen das Boot gar tragen oder ziehen, so wenig Wasser führte er mit sich. Dass der Fluss bei doppelt so hohem Wasserstand eine doppelt so starke Strömung hatte, lag nun klar auf der Hand; dass unsere Kleider allesamt nass werden würden, wenn wir bei einer Stromschnelle kenterten, fürchtete ich. An weitere mögliche Szenarien mochte ich gar nicht denken. Kein Vogel am niedrigen grauen Himmel, den ich nach Zeichen von Wetterverbesserung absuchte. Und auch keine Pferde, nach denen eine Nomadin Ausschau hielt. Seit Tagen schon war jede Spur von der kleinen Herde verschwunden, nun fürchtete sie, Wölfe würden sie attackieren. Am Abend war auch die Nomadin weg.
Der Start inmitten der Stromschnellen war besser als befürchtet, das Kanu legte sich tief ins Wasser und blieb schwerfällig, war nur schwer manövrierbar beim Umpaddeln der Felsen, die knapp aus dem Wasser ragten. Breitseiten schwappten ins Boot, einmal landeten wir im Ufergebüsch statt in der Strömung, die uns voranbringen würde. Am Vormittag des ersten Tages fiel auch Plan B ins Wasser, sich im Falle des Falles von einem Fahrer abholen zu lassen. Kein Empfang zeigte das Display des Handys. Und das würde auch in den nächsten Tagen so bleiben, meinten die Guides, als ich vorsichtig nachfragte. Hoffen, durchstehen, ausharren. Auch bei strömendem Regen im Zelt, von dem nachts ein Tropfen auf mein Gesicht fiel und mich weckte.

Anderntags hatte der Regen zugenommen, wir legten einen Rasttag ein. Als es nur noch nieselte, schlenderte ich durch hohes Gras zu einem Bach, da spürte ich auf einmal, wie der Boden bebte. Ich sah auf, ein mongolischer Jugendlicher saß auf einem Pferd und durchschritt den Bach. Als er am anderen Ufer davongaloppierte, sah man über den Gräsern nur noch seine blaue Trainingsjacke und rote Baseballkappe. Ohne besonderes Ziel vor Augen folgte ich dem Adler, der hoch oben über der steinernen Kuppel eines Hügels enge Kreise zog, bald stand ich oben. Der Blick war überwältigend – war er es wirklich? Denn an wie vielen einsamen und ausgedehnten Tälern und Weiden hatte ich mich in meinem Leben schon satt gesehen? Der Anblick war mir vertraut, verwundert war ich nur, kein Zeichen von Zivilisation ausmachen zu können, auch nicht in einem sattgrünen schmalen Tal, durch das ein Bach mäanderte. Ich ging am Grat entlang, den ich von Weitem fälschlicherweise für solch einen gehalten hatte, denn dahinter zog sich eine weite Ebene hin. Und bei jedem Schritt meinte ich, aus der Ferne Rufe zu hören, ein Singen vielleicht, wie wenn einer eine Herde zusammentreibt. Doch immer, wenn ich stehen blieb, war nichts zu hören. Vor mir glänzte etwas am Boden, die Überreste einer Plastikflasche, zwischen zwei Grasbüscheln hing eine Plastiktüte, einem Schuh fehlte der Absatz, ein paar Schritte weiter tauchte der Schaft eines Stiefels auf. Neben einer Feuerstelle lag ein Regal aus Metall, vom Wind hierhergeweht? Warum sollten Menschen das Gerümpel auf den Hügel schleppen, wenn es genauso gut anderswo hätte verrotten können? Ich hob das Horn eines Rindes auf, schaute hindurch auf den Fluss weit unten und ließ es wieder fallen.
Der dritte Tag begann trocken, doch kaum waren wir gestartet, kenterte ein Boot, und kurze Zeit später setzte der Regen ein, der bis zum Abend nicht aufhören sollte. Völlig aufgeweicht schlugen wir in der Abenddämmerung das Lager unter einer Baumgruppe auf und trockneten die Kleider am Feuer.

An den folgenden Tagen wurden wir geweckt vom Reißen des Flusses, von schwerfälligen Insekten, die kaum fliegen und offensichtlich noch nicht einmal die grellorange Zeltplane sehen können, wieder und wieder dagegen prallten, dass alles vibriert; von Kühen und Hunden, die hinter dem nächsten Hügel das Vieh zusammenbellten; von vorsichtigen Schritten –eines Bären? – rund um das Lebensmittelzelt; von Schafen, Pferden, dem Wind.
Aus der Ferne erinnerte das einzige Dorf auf der Strecke, in dem wir unseren Proviant aufstocken würden, an Fotografien von sibirischen Siedlungen mit bunten Dächern. Während des Wartens auf die anderen, die ins Dorf gegangen waren, um Thunfisch mit Kimchi, Schokolade, Trinkwasser und eine Flasche Goldener Dschingis Khan zu besorgen, durchquerte eine Kuhherde stolpernd und schwimmend den Orchon: Eine Kuh nach der anderen ging wie an einem unsichtbaren Fährseil entlang. Um uns saß eine 11-köpfige mongolische Familie, die uns anschaute, wir schauten zurück, sprachen in unseren eigenen Sprachen und taten und nickten, als ob man den anderen bestens verstünde.

Am Abend lagerten wir auf einer Flussinsel, am anderen Ufer stand eine blendend weiße Jurte, ein Ger, wie die Mongolen sagen. Eine Frau trat heraus, als unsere Kanus auf der Insel anlandeten. Der Boden bebte selbst hier, als drüben in dunstiger Ferne zwei Reiter eine riesige Schafherde zusammentrieben. Die Schafsrücken wogten wie Gischt durch das grüne Meer. Immer wieder ritt einer der Mongolen zurück, um ein Schaf oder eine Kuh – das war aus der Ferne nicht immer auszumachen – zurückzutreiben. Bis alle beide durch ein schwarzes Rinnsal ritten, die Furt querten und auf uns zukamen. Dachte ich. Doch sie fingen zwei ausgewachsene Rinder ein und trieben sie zurück. Auf der ganzen Insel verstreut, lagen zwischen Kuhfladen, Kötel und Pferdeäpfeln ausgebleichte Schädelknochen, Gelenke, Wirbel. Dazwischen leere Wodkaflaschen.
Tagsüber versuchte ich, den Paddelschlag dem Atem anzupassen. Gelang nicht immer, das Tagträumen schon, den Blick dem Ufer entlang gleiten lassen, den Kanten der Berge, die sich auftürmten, mancherorts schienen Riesen mit Felsen gespielt zu haben, so seltsam gehäuft lagen sie an den Hängen. Und nichts hätte an die Welt anderswo erinnert, wäre nicht beständiges Gedröhn aus dem Himmel zu hören gewesen, ohne die Flugzeuge je zu Gesicht zu bekommen.

Einmal waren wir unversehens im Schilf gelandet, die Strömung war so stark gewesen, dass kein Paddelschlag dagegen ankam und wir nach links abtrieben. Einer der Guides stand bärengleich breitbeinig im Wasser und zog gleich zwei Kanus wieder zurück in die Strömung, die hier so laut toste, dass er schreien musste: „Double left“ und den großen Fels schräg vorn passieren, dann links in die Strömung rein und los. Hätten wir ihn nicht gehabt, hätten wir uns den Weg dicht am schilfigen Ufer gesucht, wo uns das Wasser gegen die Felsen gedrückt hätte – das sah ich erst, als ich mich nach dem Passieren dieser Stelle umdrehte.
Kein Gefühl mehr für die Zeit, Tage, Wochentage. Nachts meinte ich, einem Wispern zu lauschen, das Wasser murmelt, endlich verstand ich dieses Bild, aber nicht die Sprache des Flusses. Anders wie der Guide Banzai, der, wenn es darauf ankam, breitbeinig im Kanu stand, um den Fluss „zu lesen“.
Eines Tages, gegen Ende der Reise, besuchten wir eine Familie in ihrer Jurte, unsere Guides brachten ihnen Mayonnaise und Konfitüre mit. Ein Pferdeposter hing neben dem Eingang und ein Wandteppich mit Pferdeköpfen, auf dem Regal stand ein Fernseher und flackerte vor sich hin. Der Gastgeber saß auf einem Bettgestell, eine Frau schenkte Milchtee ein und stellte zwei große Schüsseln vor uns hin, die eine mit frittierten Krapfen, die andere mit Milchgebäck. Wie passten Frau und Mann zusammen, rätselten wir, da sie viel älter schien als er? Der älteste Sohn starrte uns aus großen und dunklen Augen unverwandt an, ein spitzbübisches Gesicht hatte sein jüngerer Bruder, der später kam und eine junge Ziege brachte, gerade mal zehn Stunden alt. Nach einer Weile erhob sich der Mann, ging zu einem Wandschrank und holte eine blaue Plastikflasche hervor. Die Flüssigkeit darin war trüb, fermentierte Molke mit einem niedrigen Alkoholgehalt, wurde uns versichert, und wir nahmen alle einen Schluck, was der Gastgeber wohlwollend zur Kenntnis nahm.
 Als wir am darauffolgenden Tag im Regen die Zelte abbauten, kamen zwei Mongolen auf einem Motorrad. Waren es die beiden, die wir eine Stunde später am linken Ufer wiedersahen? Unsere Guides hielten jedenfalls am rechten Ufer. Erst nach einer Weile verstanden wir, was da vor sich ging: Ein junger Mann am gegenüberliegenden Ufer versuchte, eine Pferdeherde zum Fluss, also ans andere Ufer zu treiben. Banzai sollte mit seinem roten Paddel die Ausbruchversuche der Hengste verhindern, doch es gelang ihm nicht. Die beiden Männer am anderen Ufer, an dem wir festgemacht hatten, sahen zu. Irgendwann fragten wir den Ältesten gestenreich, ob er denn nicht ans andere Ufer wolle? Flugs stand er auf, raffte seinen Mantel zusammen und stieg trotz der unter Mongolen offenbar verbreiteten Angst vor Wasser ins Kanu, setzte sich auf die blaue Kleidertonne und ritt so über den Strom. Doch auch zu fünft konnten sie nichts ausrichten, die Pferde wollten nicht zurück ins Wasser.
Als wir am darauffolgenden Tag im Regen die Zelte abbauten, kamen zwei Mongolen auf einem Motorrad. Waren es die beiden, die wir eine Stunde später am linken Ufer wiedersahen? Unsere Guides hielten jedenfalls am rechten Ufer. Erst nach einer Weile verstanden wir, was da vor sich ging: Ein junger Mann am gegenüberliegenden Ufer versuchte, eine Pferdeherde zum Fluss, also ans andere Ufer zu treiben. Banzai sollte mit seinem roten Paddel die Ausbruchversuche der Hengste verhindern, doch es gelang ihm nicht. Die beiden Männer am anderen Ufer, an dem wir festgemacht hatten, sahen zu. Irgendwann fragten wir den Ältesten gestenreich, ob er denn nicht ans andere Ufer wolle? Flugs stand er auf, raffte seinen Mantel zusammen und stieg trotz der unter Mongolen offenbar verbreiteten Angst vor Wasser ins Kanu, setzte sich auf die blaue Kleidertonne und ritt so über den Strom. Doch auch zu fünft konnten sie nichts ausrichten, die Pferde wollten nicht zurück ins Wasser.
Und das alles war nicht etwa ein Zufall, sondern zeigt, wie Kommunikation in der Mongolei funktioniert. Als wir gestern die Nomaden besuchten, hatte der Mann erzählt, er habe einen Freund, dessen Herde auf der anderen Flussseite sei. Die müsse er zurückholen, sonst würden womöglich Wölfe die Pferde angreifen. Dieser Freund war es, der am Morgen mit dem Motorrad gekommen war, um unsere Guides zu bitten, dass sie ihnen flussabwärts beim Zusammentreiben der Herde helfen sollten. Wie aber waren die Pferde auf die andere Seite gelangt, wenn sie sich jetzt so widerspenstig anstellten? Man hätte sie, als der Wasserstand noch niedriger war, auf die andere Seite getrieben, weil dort das Gras besser sei. Nun müsse man halt warten und es später noch einmal versuchen. Aber warum führte keiner der Männer ein Seil, eine Lassostange oder ähnliches Gerät mit sich?

Gewitterwolken türmten sich auf über Gebirgszügen, peitschten das Wasser vor sich her, dass es sich kräuselte und spritzte, kein Regen fiel, für eine Weile zumindest, und erst als wir dachten, das Gewitter hätte sich verzogen, fing es an, zuerst nur ein paar Tropfen, dann ein Wolkensturz. Später tauchten am linken Ufer braune Tiere auf, größer als Pferde, auch wehte der Wind einen Geruch über den Orchon, der anders war. Kamele! Wie aus dem Nichts. Staunten uns an, wie wir sie anstaunten.
Am letzten Tag eine Traurigkeit wie über den Verlust von etwas, was schon all die Tage zuvor so schwer in Worte zu fassen war. Natur, Wasser, Nichts, nur Dahintreiben.
Infos: Kanureisen in der Mongolei organisiert Ernst von Waldenfels, der Orchon ist für Einsteiger mit Kanuerfahrung geeignet.


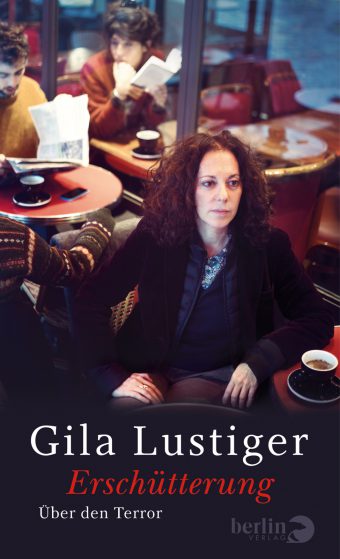 Weil Gila Lustiger verstehen wollte, wie es zu den Attentaten am 13. November 2015 in Paris kommen konnte, versucht sie zu verstehen, warum zehn Jahre zuvor in den Pariser Banlieus und im Norden Frankreichs mehrheitlich Jugendliche „mit Migrationshintergrund“ alles zerstörten, was um sie war. Und sie stellt Fragen, die immer wieder ins Leere laufen. Wie viele Hiphop-Kurse werden in einem Vorortzentrum organisiert und scheinen doch kaum mehr zu sein als ein Feigenblatt für das schlechte Gewissen der Nation? Und was bitte sehr hätten sie mit Terrorvermeidung zu tun? Warum z.B. werden gerade junge Lehrer direkt nach dem Studium in Brennpunkt-Schulen geschickt, ja verheizt, weshalb nirgendwo sonst im Lande der Lehrerwechsel so häufig sei wie hier? Wo Schulen und Bibliotheken brennen, in denen eigentlich nur das Beste gewollt wird? „Viele der Randalierer waren Schulabbrecher, und ihr Hass galt nicht nur dem Buch, sondern auch ganz allgemein dem geschriebenen Wort, das sie als Instrument ihrer Unterwerfung empfanden. […] Sprache, das waren Gebote und Verbote. Nichts, als eine weitere Strategie, sie zu zähmen.“ Terror als logische Folge, da radikalste Integrationsverweigerung.
Weil Gila Lustiger verstehen wollte, wie es zu den Attentaten am 13. November 2015 in Paris kommen konnte, versucht sie zu verstehen, warum zehn Jahre zuvor in den Pariser Banlieus und im Norden Frankreichs mehrheitlich Jugendliche „mit Migrationshintergrund“ alles zerstörten, was um sie war. Und sie stellt Fragen, die immer wieder ins Leere laufen. Wie viele Hiphop-Kurse werden in einem Vorortzentrum organisiert und scheinen doch kaum mehr zu sein als ein Feigenblatt für das schlechte Gewissen der Nation? Und was bitte sehr hätten sie mit Terrorvermeidung zu tun? Warum z.B. werden gerade junge Lehrer direkt nach dem Studium in Brennpunkt-Schulen geschickt, ja verheizt, weshalb nirgendwo sonst im Lande der Lehrerwechsel so häufig sei wie hier? Wo Schulen und Bibliotheken brennen, in denen eigentlich nur das Beste gewollt wird? „Viele der Randalierer waren Schulabbrecher, und ihr Hass galt nicht nur dem Buch, sondern auch ganz allgemein dem geschriebenen Wort, das sie als Instrument ihrer Unterwerfung empfanden. […] Sprache, das waren Gebote und Verbote. Nichts, als eine weitere Strategie, sie zu zähmen.“ Terror als logische Folge, da radikalste Integrationsverweigerung.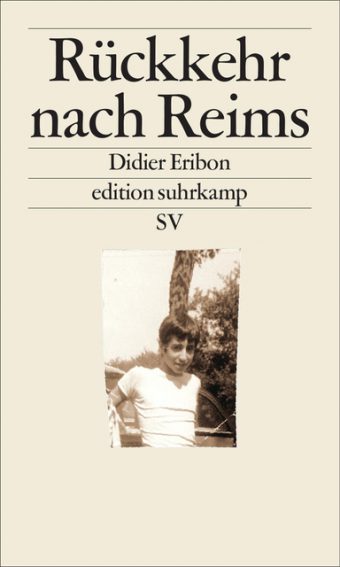 Die Banlieusards nehmen auch kaum an Wahlen teil, stattdessen wird der Gegensatz von „Die da oben und wir da unten“ von Marie le Pen geschickt aufgegriffen, deren größte Wählerschaft die 18- bis 24 Jährigen sind. Der Feind ist nicht mehr nur der Ausländer, sondern das ganze Establishment. Und die Rechten aller Länder wissen diese Angst zu schüren und zu nutzen. Dies analysiert treffend auch der Soziologe Didier Eribon in der autobiografisch-soziologischen Reflexion Rückkehr nach Reims.
Die Banlieusards nehmen auch kaum an Wahlen teil, stattdessen wird der Gegensatz von „Die da oben und wir da unten“ von Marie le Pen geschickt aufgegriffen, deren größte Wählerschaft die 18- bis 24 Jährigen sind. Der Feind ist nicht mehr nur der Ausländer, sondern das ganze Establishment. Und die Rechten aller Länder wissen diese Angst zu schüren und zu nutzen. Dies analysiert treffend auch der Soziologe Didier Eribon in der autobiografisch-soziologischen Reflexion Rückkehr nach Reims. Wie viele Künstler oder kreativ Tätige gehören zum Prekariat? Und wie sieht das im Verlagswesen aus, bei den Grafikern, Lektoren, Korrektorinnen? Wenn Selbstausbeutung nicht mehr funktioniert, weil eine Familie zu ernähren ist?
Wie viele Künstler oder kreativ Tätige gehören zum Prekariat? Und wie sieht das im Verlagswesen aus, bei den Grafikern, Lektoren, Korrektorinnen? Wenn Selbstausbeutung nicht mehr funktioniert, weil eine Familie zu ernähren ist? Lesung.
Lesung.
 Offensichtlich hatte ich nicht wirklich über die Einzelheiten nachgedacht: zehn Tage nur mit dem Notwendigsten auf einem mongolischen Fluss. Bei meinen Recherchen vorab im Internet fand ich den Strom, der gegen Norden Richtung Russland fließt, eher flach, als müsste man an manchen Stellen das Boot gar tragen oder ziehen, so wenig Wasser führte er mit sich. Dass der Fluss bei doppelt so hohem Wasserstand eine doppelt so starke Strömung hatte, lag nun klar auf der Hand; dass unsere Kleider allesamt nass werden würden, wenn wir bei einer Stromschnelle kenterten, fürchtete ich. An weitere mögliche Szenarien mochte ich gar nicht denken. Kein Vogel am niedrigen grauen Himmel, den ich nach Zeichen von Wetterverbesserung absuchte. Und auch keine Pferde, nach denen eine Nomadin Ausschau hielt. Seit Tagen schon war jede Spur von der kleinen Herde verschwunden, nun fürchtete sie, Wölfe würden sie attackieren. Am Abend war auch die Nomadin weg.
Offensichtlich hatte ich nicht wirklich über die Einzelheiten nachgedacht: zehn Tage nur mit dem Notwendigsten auf einem mongolischen Fluss. Bei meinen Recherchen vorab im Internet fand ich den Strom, der gegen Norden Richtung Russland fließt, eher flach, als müsste man an manchen Stellen das Boot gar tragen oder ziehen, so wenig Wasser führte er mit sich. Dass der Fluss bei doppelt so hohem Wasserstand eine doppelt so starke Strömung hatte, lag nun klar auf der Hand; dass unsere Kleider allesamt nass werden würden, wenn wir bei einer Stromschnelle kenterten, fürchtete ich. An weitere mögliche Szenarien mochte ich gar nicht denken. Kein Vogel am niedrigen grauen Himmel, den ich nach Zeichen von Wetterverbesserung absuchte. Und auch keine Pferde, nach denen eine Nomadin Ausschau hielt. Seit Tagen schon war jede Spur von der kleinen Herde verschwunden, nun fürchtete sie, Wölfe würden sie attackieren. Am Abend war auch die Nomadin weg.



 Als wir am darauffolgenden Tag im Regen die Zelte abbauten, kamen zwei Mongolen auf einem Motorrad. Waren es die beiden, die wir eine Stunde später am linken Ufer wiedersahen? Unsere Guides hielten jedenfalls am rechten Ufer. Erst nach einer Weile verstanden wir, was da vor sich ging: Ein junger Mann am gegenüberliegenden Ufer versuchte, eine Pferdeherde zum Fluss, also ans andere Ufer zu treiben. Banzai sollte mit seinem roten Paddel die Ausbruchversuche der Hengste verhindern, doch es gelang ihm nicht. Die beiden Männer am anderen Ufer, an dem wir festgemacht hatten, sahen zu. Irgendwann fragten wir den Ältesten gestenreich, ob er denn nicht ans andere Ufer wolle? Flugs stand er auf, raffte seinen Mantel zusammen und stieg trotz der unter Mongolen offenbar verbreiteten Angst vor Wasser ins Kanu, setzte sich auf die blaue Kleidertonne und ritt so über den Strom. Doch auch zu fünft konnten sie nichts ausrichten, die Pferde wollten nicht zurück ins Wasser.
Als wir am darauffolgenden Tag im Regen die Zelte abbauten, kamen zwei Mongolen auf einem Motorrad. Waren es die beiden, die wir eine Stunde später am linken Ufer wiedersahen? Unsere Guides hielten jedenfalls am rechten Ufer. Erst nach einer Weile verstanden wir, was da vor sich ging: Ein junger Mann am gegenüberliegenden Ufer versuchte, eine Pferdeherde zum Fluss, also ans andere Ufer zu treiben. Banzai sollte mit seinem roten Paddel die Ausbruchversuche der Hengste verhindern, doch es gelang ihm nicht. Die beiden Männer am anderen Ufer, an dem wir festgemacht hatten, sahen zu. Irgendwann fragten wir den Ältesten gestenreich, ob er denn nicht ans andere Ufer wolle? Flugs stand er auf, raffte seinen Mantel zusammen und stieg trotz der unter Mongolen offenbar verbreiteten Angst vor Wasser ins Kanu, setzte sich auf die blaue Kleidertonne und ritt so über den Strom. Doch auch zu fünft konnten sie nichts ausrichten, die Pferde wollten nicht zurück ins Wasser.










 n spektakuläres Familiengeheimnis entdecken, doch die Geschichte um eine junge entflammende Liebe – garniert mit zahlreichen Erklärungen zum chinesischen Kontext – liest sich vergnüglich.
n spektakuläres Familiengeheimnis entdecken, doch die Geschichte um eine junge entflammende Liebe – garniert mit zahlreichen Erklärungen zum chinesischen Kontext – liest sich vergnüglich.
